
Begegnungen - Erzählungen
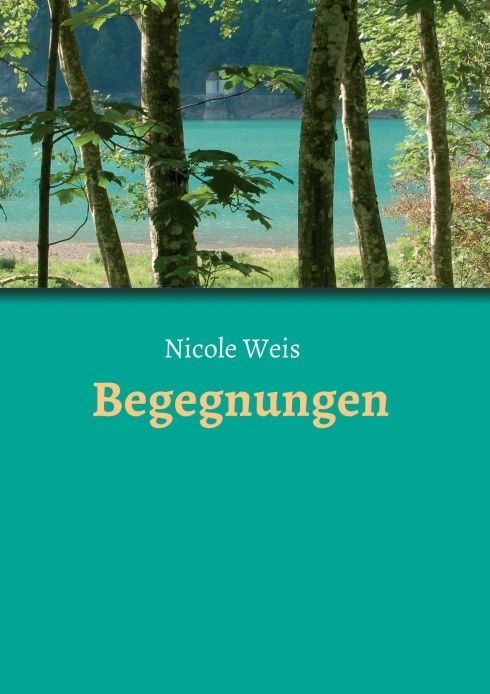
Geschichten sammeln.
Seit einigen Jahrzehnten schreibe ich Erzählungen, die ich bald in einem Sammelband veröffentlichen möchte. Vieles davon habe ich selbst erlebt, so wie einen Stromausfall im Jahr 1995 im Kantonsspital Glarus in der Schweiz. Diese Geschichte von einem Krankenhaus, das für kurze Zeit ein Gesundheitshaus wurde, wird in der Leseprobe erzählt.
Details
-
Erzählungen
-
Voraussichtlicher Erscheinungstermin: noch unbekannt
Leseprobe
Die Stromfinsternis
Ich kenne ein Krankenhaus, das für kurze Zeit ein Gesundheitshaus war. Ein Krankenhaus, in dem die Menschen Flügel bekamen und das Wort Menschlichkeit seine ursprüngliche Bedeutung wiedererlangte.
Dieses Krankenhaus war knapp vierzehn Stunden lang ein Hort der Freundlichkeit, eine Zuflucht für die Wärme, die in den Herzen der Menschen schlafen gelegt war. In diesem Krankenhaus wurden Visionen mit Taschenlampen angeleuchtet, und der Austausch von Gedanken fand nicht länger hinter verschlossenen Türen statt. Die Menschen sprachen wieder miteinander, sie sprachen sich Trost zu und nahmen sich Zeit für die Alltäglichkeiten des anderen, für den Schmerz im Glücklich sein.
Dieser plötzliche Wandel konnte allerdings nur stattfinden, weil ein einziges technisches Gerät ausgefallen war, von dem es abhing, ob das Wunder der Elektrizität die Innereien des Krankenhauses erreichen konnte oder nicht. Als es passierte, war ich gerade im Begriff, zur Röntgenabteilung zu gehen und benutzte dazu das in der Nähe des Altbaus gelegene Treppenhaus. Von dort aus hatte ich einen atemberaubenden Blick auf den Ennetberg und die verlassenen Alphütten. Ich war so in die Schönheit der Landschaft versunken, dass ich nicht bemerkte, wie ein Teil der alten Stromzentrale in sich zusammenbrach. Ohne Vorankündigung ertönte ein gewaltiger Knall, und wie eine Art Echo auf dieses Geräusch verstummte die gesamte Tonleiter des elektrischen Stroms. Das Licht ging aus, Computerbildschirme erloschen, und alle medizinischen Apparate liefen fortan auf zeitlich begrenzten Batteriebetrieb. Jegliche Hoffnung auf medizinischen Fortschritt wurde durch dieses Ereignis zunichtegemacht, sogar fast ins Lächerliche gezogen durch die Abhängigkeit der Medizin vom Gehirn der Stromzentrale.
Während medizinisches Personal geschäftig die Treppen hoch und runter lief, starrte ich wie gebannt auf die Überreste des kleinen Häuschens, das nun schon seit Monaten vom Abriss verschont geblieben war. Mit Absicht, wie sich später herausstellte, da in diesem unscheinbaren Haus die Verteilerzentrale arbeitete, ohne die das Krankenhaus nicht existieren konnte. Es konnte vielleicht doch, wie ich später mit eigenen Augen erfuhr. Aber es war dann nicht mehr dasselbe wie vorher. Es wurde verletzlicher, und aus der Institution „Krankenhaus“ wurde mangels Licht eine Geburtsstätte zwischenmenschlichen Friedens. Die Wehen dieses gewaltigen Organismus setzten allerdings viel zu frühzeitig und unerwartet ein, so dass die Geburt mit allen Mitteln verhindert werden musste. Die Welt war einfach noch nicht so weit. Insbesondere die Ärzteschaft erschrak vor den fast unlösbaren Problemen, die eine Bahrfußmedizin im Zeitalter der Zivilisation mit sich brachte. Und auch die Bevölkerung, einschließlich des Stadtpräsidenten, geriet sichtlich in Unruhe, als sich die Nachricht von der Stromfinsternis im Krankenhaus wie die Feuer zum 1. August verbreitete.
Und so gab es neben dem großen menschlichen Umbruch auch etwas anderes, ebenso Wichtiges, das in den Köpfen der unmittelbar Verantwortlichen stattfand und sie von einem Augenblick zum anderen zu Hoffnungsträgern eines ganzen Kantons werden ließ. Es war eine fast archaisch wirkende Angst vor den Folgen dieser Finsternis, vor den menschlichen und finanziellen Folgen eines anhaltenden Chaos. Zum Glück geschah das Ganze um etwa 17 Uhr, so dass der Operationsbetrieb bis auf eine Augenoperation, die mit der Taschenlampe zu Ende geführt werden konnte, schon beendet war. Außerdem wurde auf der Intensivstation niemand künstlich beatmet, so dass zum Zeitpunkt des Stromausfalles für keinen Patienten eine akute Lebensgefährdung bestand. Um dieses auch in Zukunft ausschließen zu können, wurde in äußerster Eile der Notstand ausgerufen und ein Krisenstab gebildet, der alles Notwendige beschließen und unter Kontrolle halten sollte.
Ich habe dies natürlich erst viel später erfahren, nachdem ich meinen Fensterplatz längst wieder verlassen hatte. Aber schon in den ersten Minuten nach dem mächtigen Knall ahnte ich die Bedeutung dieses Vorfalls für die aufgeregt herbeilaufenden Menschen, darunter Chefärzte und Verwaltungsbeamte, die über Trümmer von Zement stiegen, als hätten sie in ihrem Leben nie etwas anderes getan. Ihre Gesten sagten mir, dass der Schaden nicht ohne weiteres zu beheben sein würde und dass eine Unmenge von Technikern aufgeboten werden musste, um wenigstens in Ansätzen die Lage unter Kontrolle bringen zu können. Dies geschah dann auch. Schon nach einer halben Stunde schienen sich auf dem Abrissgelände mehr Menschen zu tummeln als im gesamten Krankenhaus. In diesem Moment konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Denn die geschäftige Unruhe der Leute dort draußen stand ganz im Gegensatz zu der inzwischen eingekehrten Ruhe inmitten des Treppenhauses, in dem ich am Fenster stand und mich mit einigen Patienten über den Ausblick unterhielt. Schließlich fragte mich jemand entgegen meines ärztlichen Aussehens über genaue technische Einzelheiten aus. Ein anderer redete etwas von Kilowattstunden, und eine Dritte, eine Kinderstimme, klärte die verwundert hereinblickenden Erwachsenen über die Kurzlebigkeit von Glühbirnen auf. Der angenehme Klang dieser Stimme machte mich neugierig, und so verabschiedete ich mich nach dem Vortrag des Jungen von den Patienten, um auf die Station zu gehen. Vielleicht war dort mehr zu erfahren.
Als ich die Tür zur Station öffnete, wusste ich, dass dies kein Krankenhaus mehr war. Jedenfalls kein Krankenhaus im üblichen Sinne, so wie man es sich landläufig vorstellt. Das Erste, was ich bemerkte, war eine Dunkelheit, die sich auf dem Flur ausbreitete. Dann sah ich, dass die Türen zu den Patientenzimmern weit geöffnet waren und dass vor den Zimmern die Schwestern standen und sich mit den Patienten unterhielten. Einige von ihnen teilten Taschenlampen aus, und wiederum andere sprachen beruhigende Worte zu ängstlichen Menschen, von denen trotz der Dunkelheit die Tränen sichtbar waren. Wer alle Sinne offen ließ, konnte sie spüren; diese Augen, die sich feucht anfühlten, und dieser Wunsch nach Zuwendung in den Händen der schwachen und alten Menschen. Und wiederum Hände, die zudrücken konnten, die den anderen beruhigten und ihm Angst vor der Dunkelheit nahmen. Keiner konnte auf den anderen herabsehen. Irgendwie waren alle gleich, denn es war ja dunkel, und in der Dunkelheit sah man die Unterschiede nicht. Niemand achtete auf meinen weißen Kittel. Er war keine Schutzburg mehr, hinter die ich mich zurückziehen konnte, nicht länger Versteck vor bohrenden Fragen. Hier war ich ein Mensch mit Ohren, um dem anderen zuzuhören. Mit Händen, um die Dunkelheit zu überwinden. Und mit einer Stimme, die sich auf einmal sehr schön anfühlte. Ich brauchte niemandem mehr etwas von Laborwerten zu erzählen. Und wenn mich jemand erkannte, dann waren es ganz andere Dinge, auf die man achtete. Diese Dinge lernt man nicht auf der Universität. Und unter normalen Umständen weiß man nicht einmal, dass es sie gibt. Diese kleinen Wunder, die wir in uns tragen und die wir doch nie ans Tageslicht holen, weil sie zu zerbrechlich für das sterile Licht in den Gängen und Zimmern sind.
Erst als es dunkel war, lernten wir uns richtig kennen. Erst als es keine Äußerlichkeiten gab, konnten wir aufmerksam für das andere sein. Erst als das äußere Gefüge nicht viel mehr als ein wackliges Baugerüst war, hatten wir Zeit, Menschen zu begegnen und ihnen zuzuhören. Erst die Dunkelheit gab uns Vertrauen. Erst die Stromfinsternis gab uns Licht.
Die Lichterkette, die aus Gedanken bestand und die jeder hinter sich herzog, ließ uns den elektrischen Strom nicht vermissen. Irgendwie hatte jeder wieder mehr Freude an der Arbeit. Ich sah, wie sich an den Fenstern Gruppen bildeten, die in die allmählich einsetzende Dämmerung hinausschauten. Ich sah das Tageslicht weniger werden und hörte, wie die Freude unter den Menschen zu wachsen begann. Ich spürte die Gemeinschaft, die gerade dabei war, sich auszudehnen und dachte liebevoll an die Menschen, die bereit gewesen waren, so zu sein. Auf einmal war es leicht zu lächeln. Ich merkte es auf dem Weg zu meinem Zimmer, als gerade das letzte Licht des Tages in den Flur hereinschien und in einiger Entfernung die Taschenlampen angingen. Die Taschenlampen gaben nicht viel Licht. Nur das Nötigste wurde damit angeleuchtet und sichtbar gemacht. Schritte einer Frau den Gang entlang. Aufsetzen eines Mannes im Bett. Dem Nachgehen von Worten aus einem Zimmer. Unverständliches Rufen im Traum. Wegrücken eines Stuhles vom Bettrand. Das Schütteln von Kissen vor dem Schlaf. Trockene Lippen, die lachen, weil das Leben so zart und zerbrechlich ist.
Ich warte. Alle scheinen zu warten. Nur nicht auf das Notlicht, das um Mitternacht herum im Flur angeht und uns wieder etwas Licht gibt. Ich denke, noch ein bisschen mehr Strom und ich würde zu atmen aufhören. Noch ein bisschen mehr von dieser entsetzlichen Helligkeit und ich würde anfangen zu schreien. Dass ich dies nicht getan habe, ist einzig und allein der Freude über die Menschlichkeit in den Gesichtern zu verdanken, die das angegangene Notlicht nicht ganz so hell erscheinen ließ.
Doch kehren wir wieder zurück zu dem, was inzwischen geschah, was in den Augen der Verantwortlichen geschehen musste, um die Arbeit an den Computern wiederaufnehmen und am frühen Morgen die „Leistenbrüche“ operieren zu können, die schon seit drei Monaten auf ihren Termin warteten. Um es anders auszudrücken, es musste eine Katastrophe abgewendet werden. Es musste jeder kleinsten Wahrscheinlichkeit vorgesorgt werden, damit im Falle eines Falles die medizinische Versorgung der Kantonsbevölkerung wieder gewährleistet war. Und dies bedeutete, den Strom wieder anzuschalten. Doch wer ist imstande, eine derartige Arbeit, die unter normalen Voraussetzungen sechs Wochen dauern würde, in wenigen Stunden zu vollbringen? Diese Leistung konnte nur von hochspezialisierten Individuen erbracht werden, die alles Wissen daransetzen würden, um den medizinischen Fortschritt wieder zum Leben zu erwecken. Dass dies in nur vierzehn Stunden gelang, grenzte fast an ein Wunder. Dass das eigentliche Wunder aber woanders stattgefunden hat, nämlich in den Köpfen der Menschen, die sich zutrauten, in den dunklen Gängen aufeinander zuzugehen, hat kaum jemand bemerkt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich das öffentliche Interesse während dieser Stunden ausschließlich auf die Beschlüsse des Krisenstabes konzentrierte, während ich in den Gängen eines Gesundheitshauses die Zeit verlor.
In den hohen Räumen des Konferenzsaales hingegen, wo schon seit mehreren Stunden der Krisenstab tagte, zerrann die Zeit. Die Zeit war zäh wie Teer und festigte nur langsam den Weg, den schließlich alle gehen wollten. Der Weg hieß Sicherheit. Er hieß Strom und Fortschrittsgläubigkeit. Und es gab sogar einen Menschen im Krisenstab, der das Wort Vertrauen aussprach. Er sagte es jedoch sehr leise, fast wie zu sich selbst, so dass es im Augenblick der Aufregung und der begeisterten Reden nicht verstanden wurde. Schließlich flog dieses Wort davon und machte auf seiner luftigen Reise keine Schlagzeilen. Das Vertrauen in eine menschliche Medizin war in den Augen der Politiker und Ärzte zu beschwingt, um an Konsistenz zu gewinnen. Die Abhängigkeit vom Strom und vom Fortschritt der Medizin war im Laufe der Jahre bereits zu groß geworden, zu mächtig, und das Land schrie nach Auflösung. Es schrie nach dem Fließen elektrischen Stroms, der für alle unentbehrlich war.
Für viele war darum die Leistung der Techniker ein heroischer Akt, gleichsam ein Heraufbeschwören von biblischen Kräften, die es den Menschen erlaubte, im Zeitalter der technischen Pannen zu bestehen. Sogar in weit entfernten Städten, die noch nie etwas von dem Ort, in dem sich das Krankenhaus befand, gehört hatten, wurde die freudige Nachricht von der Auflösung der Stromfinsternis kundgetan.
Und so geschah es auch, dass nur wenige begreifen konnten, was wirklich geschah. Nur wenige hatten die Hoffnung nicht wieder aufgegeben, dass das Geschehene immer wieder geschehen konnte.
Ich kannte ein Krankenhaus, das für kurze Zeit ein Gesundheitshaus war. Ich kannte es so gut, dass ich seinen Namen vergaß und für einen Moment lang daran glaubte, es könne überall sein.
